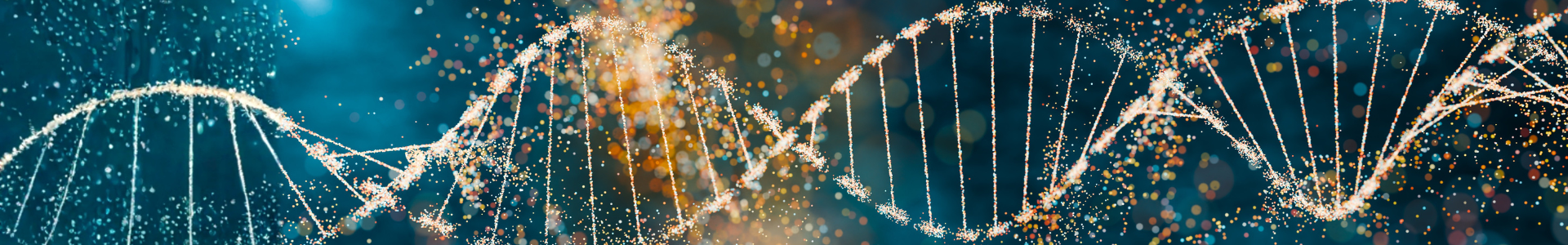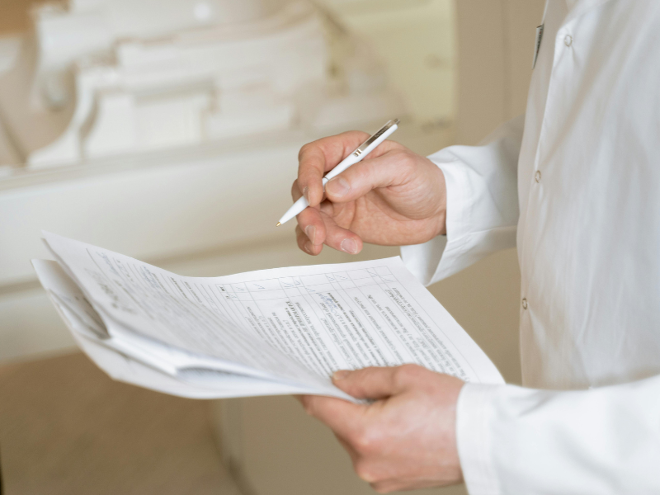Grüne Gentechnik - Informationen für KonsumentInnen, Studien und Berichte
Die grüne Gentechnik bietet weitreichende Chancen für die Landwirtschaft, die Umwelt und die globale Ernährungssicherheit. Gleichzeitig sind ihre Anwendungen mit Unsicherheiten und gesellschaftlichen Kontroversen verbunden. Eine differenzierte Bewertung unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse, ethischer Prinzipien und gesellschaftlicher Akzeptanz ist daher unerlässlich.
Die grüne Gentechnik umfasst die Anwendung gentechnischer Methoden im Bereich der Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung. Dabei werden gezielt Gene in das Erbgut von Nutzpflanzen eingeführt, entfernt oder verändert, um bestimmte Eigenschaften zu verstärken oder neue Merkmale zu etablieren.
Sie ist ein Teilbereich der modernen Biotechnologie und unterscheidet sich von der roten Gentechnik (Medizin und Pharmazie) sowie der weißen Gentechnik (industrielle Anwendungen, z. B. Enzymproduktion).
Ziele und Anwendungsgebiete
Die grüne Gentechnik verfolgt verschiedene agrarwirtschaftliche, ökologische und ernährungsphysiologische Ziele:
- Ertragssteigerung durch verbessertes Wachstum oder höhere Stressresistenz
- Resistenz gegen Schädlinge, Krankheiten oder abiotische Stressfaktoren (z. B. Hitze, Dürre, salzhaltige Böden)
- Verringerter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch integrierten Insektenschutz (z. B. Bt-Gifte)
- Verbesserung der Nährstoffzusammensetzung (z. B. Vitaminanreicherung)
- Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln
Praxisbeispiele
Bt-Mais: Enthält ein Gen des Bakteriums Bacillus thuringiensis, das ein Protein produziert, das für bestimmte Insekten (z. B. Maiszünsler) toxisch ist. Dies reduziert den Bedarf an chemischen Insektiziden.
Herbizid-toleranter Soja: Gentechnisch veränderter Soja, der gegen bestimmte Herbizide (z. B. Glyphosat) resistent ist. Landwirte können so gezielter gegen Unkraut vorgehen.
Golden Rice: Eine gentechnisch angereicherte Reissorte, die Beta-Carotin produziert, eine Vorstufe von Vitamin A. Ziel ist die Bekämpfung von Vitamin-A-Mangel, insbesondere in südostasiatischen Ländern.
Potenzielle Vorteile
| Aspekt | Vorteil |
| Agrarwirtschaft | Höhere Erträge, geringerer Einsatz von Pestiziden |
| Umwelt | Reduzierung chemischer Belastung durch Pestizide und Herbizide |
| Entwicklungspolitik | Bekämpfung von Mangelernährung durch biofortifizierte Pflanzen |
| Klimaanpassung | Entwicklung hitze- oder trockenheitsresistenter Pflanzen |
Kritik und Risiken
Trotz der genannten Potenziale ist die grüne Gentechnik Gegenstand kontroverser gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Debatten. Zu den häufig genannten Kritikpunkten zählen:
- Unklare ökologische Langzeitfolgen: Z. B. mögliche Auswirkungen auf Nicht-Zielorganismen, Resistenzentwicklung bei Schädlingen oder Auswirkungen auf die Biodiversität.
- Gesundheitliche Bedenken: Auch wenn bislang keine eindeutig nachgewiesenen Gesundheitsrisiken bestehen, fordern Kritiker:innen eine langfristige Beobachtung.
- Abhängigkeit von Saatgutkonzernen: Gentechnisch verändertes Saatgut ist oft patentiert, was Landwirt:innen in wirtschaftliche Abhängigkeit bringen kann.
- Ethische und gesellschaftliche Fragen: Kritik an der „Technologisierung“ der Landwirtschaft sowie an der Manipulation des natürlichen Erbguts.
Rechtliche Rahmenbedingungen
In der Europäischen Union gelten sehr strenge Zulassungs- und Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Organismen (GVO):
- Der kommerzielle Anbau von GVO ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.
- Produkte, die GVO enthalten oder aus ihnen hergestellt wurden, müssen eindeutig gekennzeichnet sein.
- Einige Mitgliedstaaten – darunter Österreich – haben nationale Anbauverbote ausgesprochen.
Im Gegensatz dazu ist der Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen in Ländern wie den USA, Brasilien, Argentinien oder Indien weit verbreitet.
Mit dem Fortschritt neuer gentechnischer Verfahren wie CRISPR/Cas9 eröffnen sich neue Möglichkeiten für die präzisere und effizientere Veränderung von Pflanzeneigenschaften. Diese sogenannten neuen genomischen Techniken (NGT) werfen allerdings erneut regulatorische und ethische Fragen auf. Die Diskussion um Zulassung und Anwendung ist weiterhin im Gange – sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und globaler Ebene.
Genetisch veränderte Lebensmittel und -zutaten
Mit 18. April 2004 ist die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel in Kraft getreten. Alle Anträge auf Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Lebensmitteln sind nach dieser Verordnung zu stellen.
Mit 3. März 2006 wurde erstmals ein Produkt nach der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 zum Inverkehrbringen in der EU zugelassen. Es handelt sich dabei um Lebensmittel, die aus der genetisch veränderten Maissorte 1507 bestehen, diese enthalten oder aus dieser gewonnen werden. In der Zwischenzeit erfolgte die Marktzulassung weiterer GVOs nach dieser Rechtsvorschrift betreffend genetisch veränderten Mais, Zuckerrübe, Soja, Baumwolle und Raps. Nähere Informationen finden Sie unter folgende Links:
Zusätzlich wurden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 noch eine Reihe von Derivaten aus gentechnisch verändertem Mais, aber auch Soja, Raps, Baumwolle etc. als "bereits existierende Erzeugnisse" der Kommission gemeldet und von dieser in das Community Register of GM Food and Feed under Article 8 and 20 of the Regulation (EC) 1829/2003 aufgenommen, welche alle rechtmäßig vor dem 18. April 2004 in Verkehr gebracht worden sind. Für all diese Produkte musste - sofern deren weiteres Inverkehrbringen beabsichtigt ist - gemäß den Bestimmungen des Art. 8 ein Antrag auf Erneuerung der Zulassung nach der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 eingebracht werden.
Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission.
Übersicht der Europäischen Kommission zur Selbstbestimmung der Mitgliedstaaten über den GVO-Anbau
Das Ergebnis der Ausoptierung der Mitgliedstaaten gemäß der Übergangsphase (Art. 2c) der Richtlinie 2015/412/EU bezüglich des Anbaus von gentechnisch veränderten Organismen ist auf der Website der Europäischen Kommission abrufbar. In Summe haben 19 Mitgliedstaaten – darunter auch Österreich - erfolgreich von diesem Recht Gebrauch gemacht.